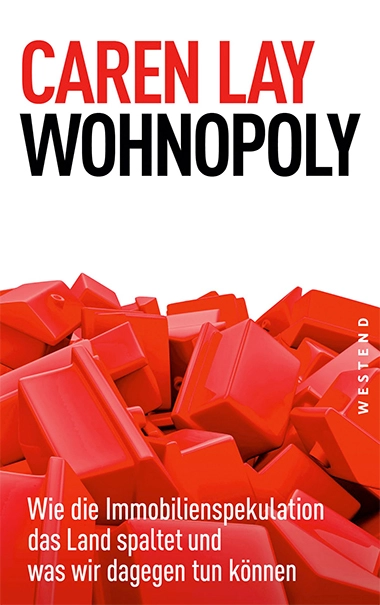frauenpolitik und so gedöns
Geschlechterverhältnisse in der Programmdebatte
Anlässlich der Vereidigung des Kabinetts 1998 äußerte Gerhardt Schröder seinen Satz von der Frauenpolitik und so Gedöns“. Hier konnte vielen Linken schon klar sein, wohin die Reise geht.
Vor allem würde es um die „harten“ Politikfelder gehen; alles andere wären bestenfalls Spielwiesen. Wenig später wurde das Schröder/Blair-Papier „Der Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten“ veröffentlicht, das für die folgende Regierungszeit wegweisend wurde bis hin zur sozialdemokratischen Erosion 2004/05. Damit wurde die Talfahrt der Sozialdemokratie eingeleitet. Als DIE LINKE müssen wir daraus Lehren für unsere Programmdebatte ziehen.
Der Kernfehler des Schröder/Blair-Papieres liegt darin, dass es sich nur auf das Verhältnis von Staat und Wirtschaft konzentriert. Eines aber ist im ganzen Text unauffindbar: das Leben der Menschen in all seiner Vielfalt. Als DIE LINKE sollten wir jedoch genau das zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen machen: Es geht um ein Leben in Freiheit und Menschenwürde für alle.
Natürlich - um auf die Eingangsfrage zu kommen – ist das Kapitalverhältnis kein Verhältnis unter vielen. Es ist eines der bestimmendsten Herrschaftsverhältnisse unserer Gesellschaft. Das bestreitet in einer demokratisch-sozialistischen Partei wohl niemand. Der Streitpunkt ist, ob sich aus dem Kapitalismus alle anderen Herrschaftsverhältnisse ableiten lassen.
Die Auffassung, dass sich das menschliche Leben auf die Ökonomie reduzieren lässt, führt in die Irre.
Entweder man landet wie die SPD im neoliberalen Lager. Doch auch ein orthodox-marxistischer, traditionell antikapitalistischer Ansatz führt nicht weiter. Linke Politik muss sich grundsätzlich allen gesellschaftlichen Fragen zuwenden. Das kann nicht gelingen, wenn der Dreh- und Angelpunkt politischer Analyse der heterosexuelle männliche Industriearbeiter ist und bleibt. Denn wir kämpfen nicht nur für Veränderungen in diesem oder jenem Bereich, sondern des gesellschaftlichen Ganzen. Deshalb gibt es für uns keinen Bereich, der als Gedöns abzuqualifizieren wäre. Denn das hieße, Minderheiten und Nebenwidersprüche zu konstruieren und im Ergebnis immer weniger Menschen anzusprechen.
Der hier diskutierte Programmentwurf von DIE LINKE reflektiert zu wenig die herrschenden heteronormativen Sichtweisen. Lesben und Schwule tauchen grade mal unter dem Punkt Antidiskriminierung auf. Dass feministische Fragen zu kurz kommen, ist ebenfalls klar. Auf der Ebene konkreter Forderungen findet sich durchaus manch Fortschrittliches im Text: Der Anspruch auf Gleichstellung aller Lebensweisen, die Abschaffung des Ehegattensplittings sowie ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft, genannt ist auch die Vier-in-einem-Perspektive.
Bei aller berechtigten Kritik am Programmentwurf geht er auf dieser konkreten Ebene tatsächlich eher über das hinaus, was gegenwärtig in DIE LINKE State of the Art ist. Dennoch gilt: Der Programmentwurf genügt einer feministischen und queeren Gesellschaftskritik und -perspektive nicht. Dass der Programmentwurf aus feministischer Sicht weiter entwickelt werden muss, war übrigens auch der Programmkommission klar. Schon alleine deshalb ist es legitim, jetzt an Veränderungen zu arbeiten.
Die fehlende Analyse aktueller Gesellschafts-und Geschlechterverhältnisse stellt dabei das größte Problem dar. Eine Analyse von Heteronormativität und Patriarchat kommt so gut wie nicht vor. Die Anerkennung anderer gesellschaftlicher Unterdrückungsverhältnisse neben der antikapitalistischen Perspektive ist jedoch unverzichtbar. Wir brauchen daher einen stärkeren Bezug auf die Frauenbewegung, einer der erfolgreichsten sozialen Bewegungen der Gegenwart. Gleiches gilt für den fehlenden Bezug auf den anhaltenden, doch erfolgreichen Kampf von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern gegen Diskriminierung und für gesellschaftliche und sexuelle Befreiung.
Selbst dort, wo im Programmentwurf der Blick auf Geschlechterungleichheit gerichtet ist, ist dieser ökonomisch geprägt und verkürzt. Ein modernes linkes Programm muss sich vielmehr die im Grunde banale Erkenntnis der Frauenbewegung zu eigen machen, dass Patriarchat und Heteronormativität älter sind als der Kapitalismus und die Frage nach Herstellung von Geschlechtergleichheit sich nicht in der sozialen Frage erschöpft. Kapitalistische Wirtschaftsweise, patriarchale Verhältnisse, struktureller Rassismus und Heteronormativität sind eigenständige, sich überlagernde Herrschaftsverhältnisse. Den Mut zu diesem differenzierten Blick auf die Verhältnisse sollte DIE LINKE haben.
Immerhin wird der Normvorstellung vom männlichen Alleinernährer im Entwurf eine Absage erteilt. Jetzt gilt es, unsere Vorschläge danach zu befragen, ob sie nur aus einer männlichen, heterosexuellen Perspektive gedacht sind oder auch der Lebensrealität von Frauen gerecht werden. Ein Beispiel ist die Rentenpolitik: Die angestrebte „Erwerbstätigenversicherung“ (statt einer „BürgerInnenversicherung“ und existenzsichernden Grundrente) ist strukturell vor dem Hintergrund des männlichen Normalarbeitsverhältnisses gedacht und daher nicht geeignet, Altersarmut von Frauen oder auch von prekär Arbeitenden jedweden Geschlechts zu verhindern. Wir brauchen vielmehr eine auskömmliche Mindestrente für jeden Menschen.
Im Programmentwurf heißt es symptomatisch für die Erwerbsarbeitsfixierung: „Die Grundlage für die Entwicklung der Produktivkräfte ist heute und auf absehbare Zeit die Erwerbsarbeit.“ Eine kritische Analyse der Reproduktionsverhältnisse fehlt. Insgesamt erweckt der Entwurf den Eindruck, dass quantitative Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit sowie gleicher Lohn für gleiche Arbeit alles sind, was DIE LINKE zu diesem Thema anzubieten hat. Demgegenüber ginge es darum, Arbeiten jenseits der „klassischen“ Erwerbsarbeit überhaupt zu sehen, Arbeitszeitverkürzung als Grundbedingung einer anderen Geschlechterordnung jenseits tradierter Arbeitsteilung zu markieren und Perspektiven jenseits der „Arbeitsgesellschaft“ zu entwickeln.
Auch in der Beschreibung der linken Zielperspektive „demokratischer Sozialismus“ ist der Entwurf genderblind. Hier rächt sich die mangelnde Analyse: Wo kein Verständnis der gegenwärtigen Geschlechterverhältnisse vorhanden ist, kann keine allgemeine Emanzipationsperspektive für die Gesamtgesellschaft erarbeitet werden.
Das jedoch brauchen wir.